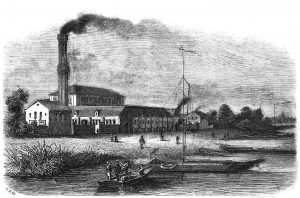
Die Frage „öffentlich oder privat“ wird spätestens seit den 1980er Jahren auch hierzulande vehement verhandelt. Doch tatsächlich reicht der Antagonismus zwischen staatlichem Engagement und privater Initiative noch viel weiter zurück. Und zwar bis zu den Wurzeln unserer heutigen Marktwirtschaft. Die seit dem 15. Jahrhundert immer weiter ausgreifenden Handelsbeziehungen hatten dem Bürgertum zu stetig wachsendem Einfluss verholfen. Umgekehrt gerieten die Privilegien einer zahlenmäßig vergleichsweise kleinen Adelskaste unter einen steigenden Legitimationsdruck. Die Revolutionen in Nordamerika oder in Frankreich bzw. die tiefgreifenden demokratischen Reformen im Vereinigten Königreich oder mit Gründung der modernen Niederlande waren Ausdruck eines unausweichlichen Prozesses, wonach sich die ökonomische Macht des Bürgertums nun auch in politischer Repräsentanz manifestieren musste. Andererseits bedurfte es im Rahmen der umfassenden Industrialisierung belastbarer Infrastrukturen und einer verlässlichen Grundlagenversorgung. Diese wiederum ließen sich kaum in marktwirtschaftlichen Konstellationen realisieren, weil 1. die Investitionskosten zu hoch und 2. konkurrierende Netze ökonomisch nicht sinnvoll erschienen. Zudem stellte sich auch ein sozialpolitisches Erfordernis für die allmähliche Herausbildung des öffentlichen Sektors. An den Ankerpunkten der Industrialisierung zeigte sich ein enormer Bedarf an Arbeitskräften, der im Rahmen einer rasanten Landflucht gestillt wurde. Die ehemaligen Bauern arbeiteten nun zwölf bis 16 Stunden in der Fabrik und hatten nicht mehr die Möglichkeit, ihre Grundbedürfnisse nach Unterkunft, Heizung, Wasser und später auch Elektrizität eigenständig zu stillen. Hier waren der Staat bzw. die Stadt gefragt, denn eine rein private Erledigung hätte niedrige Einkommen von einem Anschluss an die Netze ausgeschlossen. Dies gilt auch für angemessene Mobilitätsangebote, die in den rasant wachsenden Städten für die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsort bzw. für die täglichen Erledigungen geschaffen werden mussten. Nicht zu vergessen ist aber, dass auch private Unternehmen einen erheblichen Anteil am Aufbau moderner Versorgungsstrukturen hatten, wobei sie sich insbesondere durch eine enorme Innovativität auszeichneten. Recht bald jedoch strebten die Kommunen danach, eine eigene Kontrolle über die Grundversorgung auszuüben. Schon damals wurden dazu nicht selten partnerschaftliche Modelle mit der Privatwirtschaft gelebt.
Der Begriff „Munizipalsozialismus“ bezeichnete den Anspruch kommunaler Verwaltungen, möglichst alle Infrastrukturunternehmen in eigener Regie zu entwickeln. Damit sollte die öffentliche Hand die Grundlagen legen, dass sich der privatwirtschaftlich dominierte, industrielle Sektor möglichst umfassend, aber auch sozialverträglich entfalten kann. Die sich so herausbildende Arbeitsteilung wurde einige Jahrzehnte später durch das Modell der Daseinsvorsorge auch konzeptionell und definitorisch umrissen. Dass es beide Seiten – öffentlich und privat – irgendwie braucht, ist ein konstitutiver Grundkonsens der sozialen Marktwirtschaft bundesrepublikanischer Prägung. Gestritten wird hingegen um den Umfang beider Sektoren, um die Interdependenzen und um eine angemessene Regulierung. Nach der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre und im Rahmen des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg hatten nachfragebasierte Ansätze die Wirtschaftspolitiken der westlichen Industriestaaten dominiert. Der Staat brachte sich ein bei der Steuerung der Gesamtwirtschaft, bei der Lohngestaltung und beim Zinsniveau. Insbesondere mit Roosevelts „New Deal“ gerieten libertäre Ansätze gegenüber sozialpolitischen Reformen in die Hinterhand. Dies änderte sich in der Hochphase des Kalten Krieges. Der Ökonom Milton Friedman veröffentlichte im Jahre 1962 sein wegweisendes Werk „Kapitalismus und Freiheit“, welches unter verschiedenen Aspekten mit der bis dahin vorherrschenden keynesianistischen Schule brach. Anstatt sich wirtschaftspolitisch vornehmlich auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu fokussieren, sollten angebotsorientierte Konzepte verstärkt gewürdigt werden, so Friedman. Er selbst bezeichnete sich als Neoliberalen. Zusammen mit dem österreichischen Ökonomen und Sozialphilosophen Friedrich von Hayek begründete er eine zunehmend wirtschaftsliberale Denkschule, die in den folgenden Jahrzehnten die Politik der westlichen Industriestaaten determinieren sollte. Kernpunkt der neuen Philosophie war die Forderung nach weniger Staat und mehr Markt, Wettbewerb und individueller Freiheit. Nachdem die weltweite Wirtschaftskrise der 1930er Jahre überwunden und der Weltkrieg gewonnen war, sollte der US-Wirtschaft nun mehr Dynamik zuteilwerden – nicht zuletzt deshalb, um sich im volkswirtschaftlichen Kampf der Systeme gegen die dirigistische Zentralwirtschaft des sowjetisch dominierten Blocks durchzusetzen. Zunächst etablierte sich Friedmans Denkschule im angloamerikanischen Raum und prägte maßgeblich die Wirtschaftspolitiken unter Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Mit dem Ende des Kalten Krieges wurde sie zunehmend von den kontinentaleuropäischen Nationen adaptiert und bildete darüber hinaus den theoretischen Rahmen für die Transformation des ehemaligen Ostblocks hin zur Marktwirtschaft.
In Deutschland wurde der öffentliche Sektor nach dem Ende der sozialliberalen Koalition und mit Beginn der Kanzlerschaft Helmut Kohls massiv zurückgefahren. In dieser Zeit wurden nahezu sämtliche Industriebeteiligungen des Bundes veräußert. Mit Beginn der 1990er Jahre sollten dann die zentralen Infrastrukturdienstleister des Bundes privatisiert werden. Dies ist bei Post und Telekom mehrheitlich gelungen, während sich die Deutsche Bahn bis heute vollständig im Besitz des Bundes befindet.
Doch nicht nur auf Bundesebene geriet die öffentliche Wirtschaft unter einen stetig wachsenden Legitimationsdruck. Der Slogan „privat vor Staat“ galt in dieser Zeit weitgehend unwidersprochen auch in den Ländern und den Kommunen. Und es ist natürlich Teil der Wahrheit, dass der Siegeszug des Privaten auch deshalb so nachhaltig gelang, weil die öffentliche Wirtschaft in ihren Strukturen nicht ausreichend an betriebswirtschaftlichen Normen ausgerichtet war. Effizienz, Versorgungsqualität und Kundennähe wurden in vielen öffentlichen Unternehmen nicht hinreichend priorisiert. Einzelne Skandale, wie der der Neuen Heimat, taten ihr Übriges und so umwehte die öffentliche Wirtschaft bald der Ruch von Bürokratie, politischem Proporz, Ineffizienz und Behäbigkeit. Zusammen mit der zu dieser Zeit gängigen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrmeinung und angesichts der Implosion des realsozialistischen Konkurrenzsystems entstand eine Atmosphäre, in der sich jede wirtschaftliche Betätigung des Staates fortlaufend neu rechtfertigen musste. Mochten die kritischen Zuschreibungen insbesondere zur Kommunalwirtschaft anfangs noch einen Kern Wahrheit in sich getragen haben, verloren sie mit der zunehmenden Liberalisierung weitgehend ihre sachliche Grundlage. Viele kommunale Unternehmen haben sich im Verlauf der letzten drei Jahrzehnte spürbar professionalisiert und konnten sich auch im freien Wettbewerb durchsetzen. Dagegen hat die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008 den privaten Sektor viel Glaubwürdigkeit und Vertrauen gekostet und seitdem eine verstärkte Hinwendung zu öffentlicher Verantwortung bewirkt.
Ein neuer Trend von der Insel
Öffentlich-private Partnerschaften lassen sich in der heutigen Wahrnehmung des Begriffes weitgehend auf die zu Beginn der 1990er Jahre im Vereinigten Königreich entwickelte Private Finance Initiative zurückführen. Nach den massiven Privatisierungen der Thatcher-Ära sollten nun weite Teile des öffentlichen Infrastruktur-Sektors für privates Kapital geöffnet werden. Das Modell umfasste die Erstellung einer Infrastruktur sowie deren anschließenden Betrieb über mehrere Jahrzehnte hinweg. Als sogenannter Lebenszyklus wurde ein Zeitraum von 25 bis 30 Jahren definiert, innerhalb dessen eine vollständige Abschreibung der Kosten möglich sein sollte. Vertragspartner der öffentlichen Institutionen waren typischerweise Konsortien aus einer Bank, einem Dienstleister und einem Bauunternehmen. Diese betrieben die Infrastruktur und die öffentliche Seite hatte dafür ein regelmäßiges Entgelt zu entrichten. Die zugrundeliegenden Verträge mussten alle Eventualitäten berücksichtigen und waren daher hochkomplex.
Derartige Partnerschaften wurden auch deshalb propagiert, weil nach der gescheiterten Privatisierung von British Rail die reine Lehre von der unbedingten Privatisierung unter zunehmenden Erklärungsdruck geriet. Die Private-Finance-Initiative galt nunmehr als optimale Verknüpfung beider Sektoren. Bald wurde das Modell auch in der Bundesrepublik adaptiert. Auf beiden Seiten des Kanals zeigten sich jedoch schnell auch dessen Fallstricke. Trotz der teilweise mehrere tausend Seiten starken Verträge wurden erhebliche Nachforderungen geltend gemacht. Und viele Kommunen missbrauchten das Modell, um Schulden aus dem Kernhaushalt zu verlagern, damit die Vorgaben der kommunalen Finanzaufsicht zu umgehen und sich Dinge zu leisten, die die eigenen Möglichkeiten übersteigen. Von der enormen Komplexität der Projekte konnte vor allem die Beraterbranche profitieren. Angesichts der enormen Transaktionskosten wuchsen jedoch auch die Zweifel am anfänglich behaupteten Effizienzvorteil einer privaten Erbringung. Insbesondere die Großprojekte gaben hier wie dort Anlass zu einer kontroversen politischen Debatte. So geriet die Privatisierung der Londoner U-Bahn bald zu einem politischen Debakel. Sanierung und Betrieb des Netzes wurden auf Druck der britischen Zentralregierung an zwei private Konsortien vergeben. Doch schon nach wenigen Monaten häuften sich Unfälle und Ausfälle im Netz. Die Preise für die Tickets stiegen kontinuierlich und lagen zuletzt bei umgerechnet mehr als fünf Euro für die einfache Fahrt. Dennoch stellte zuerst das eine und später auch das andere Konsortium fest, dass sie zur Erfüllung der vereinbarten Aufgaben weitere öffentliche Zuschüsse benötigen würden. Weil diese nicht gewährt wurden, ließ man die Projektgesellschaften in Insolvenz gehen, womit die Verpflichtungen wieder auf die Stadt London übergingen. Boris Johnson, seinerzeit Bürgermeister von London, bezeichnete das ÖPP-Projekt bei der Londoner U-Bahn schlicht als Diebstahl und „als perverse Struktur byzantinischen Ausmaßes.“

Als kommunales ÖPP-Projekt stach in Deutschland vor allem die Erweiterung der Kölner Messe heraus – und zwar sowohl im Hinblick auf das Investitionsvolumen als auch in Bezug auf die öffentliche Aufmerksamkeit. Die Stadt Köln beauftragte den Fonds Oppenheim-Esch mit Bau und Betrieb der neu zu errichtenden Nordhallen der Kölner Messe. Dies geschah ohne die obligatorische europaweite Ausschreibung und zu völlig überteuerten Konditionen. Mittlerweile haben sich beide Seiten auf einen Vergleich geeinigt. Die Schulsanierungen im Kreis Offenbach oder die Erweiterung der Bundesautobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen waren weitere Projekte, die das Modell vertraglich fundierter ÖPP’s hierzulande recht nachhaltig in Verruf brachten.
Kooperation statt Autarkie
Das Zusammenwirken von öffentlicher Hand und privater Wirtschaft wird immer mit kontroversen Debatten einhergehen. Das liegt in der Natur der Sache, denn beide Seiten verfolgen verschiedene Interessen und setzen teilweise unterschiedliche Prämissen. Nicht zuletzt stehen sie auf mittlerweile liberalisierten Märkten in einer Konkurrenzsituation, drängt die Privatwirtschaft auf eine möglichst vollständige und gleichberechtigte Öffnung sämtlicher Sparten für den Wettbewerb. Natürlich ist es nachvollziehbar, wenn private Interessenten sich an öffentlichen Großprojekten beteiligen wollen. Und sie können das im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen ja auch tun. Den Auftrag zur Erweiterung von Bundesautobahnen von vier auf sechs, mitunter auch von sechs auf acht Spuren, hätte sich vermutlich ohnehin eines der großen europäischen Bauunternehmen gesichert. Wo liegt der Mehrwert, wenn anstatt einer vergleichsweise einfachen Beauftragung hochkomplexe Konstellationen geschaffen, die sämtliche Eventualitäten der kommenden drei Jahrzehnte vertraglich antizipieren müssen. Die damit verbundenen Transaktionskosten sind derart ausgreifend, dass sie kaum durch Effizienzvorteile in einem womöglich privaten Betrieb ausgeglichen werden können. Zumal das Fernstraßenbundesamt und aktuell die Autobahn GmbH des Bundes durchaus bewiesen haben, dass sie einen effizienten Betrieb sicherstellen können. Der wahre Grund für die Wahl derartiger Modelle lag in der Finanzierung. Der seinerzeitige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer brachte ÖPP recht unverhohlen in den Kontext der Schuldenbremse. Und hier wird es wirklich absurd. Wenn ein Bundesministerium die von der eigenen Regierung gesetzten Regularien umgehen will und sich deshalb in die Abhängigkeit privater Partner begibt, dann wird dies in den seltensten Fällen einer effizienten öffentlichen Haushaltsführung gerecht. Die Rechnungshöfe auf Ebene der Länder und auch der Bundesrechnungshof haben das Modell deshalb vollkommen zurecht mehrfach kritisch hinterfragt. Und es ist zu begrüßen, dass immer weniger Projekte in solche Konstellationen gepresst werden.

Schade ist eigentlich nur, dass die dringend notwendige Verschränkung und Kooperation zwischen öffentlicher Hand und privaten Unternehmen derart diskreditiert wurde. Denn wahr ist natürlich auch, dass die Vielzahl und die Massivität der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen mehr Kooperation sowie gegenseitige Befruchtung verlangen und eben nicht die Autarkie weitgehend abgeschlossener Systeme. Und umso bedauerlicher ist es, dass ein in den vergangenen Jahrzehnten äußerst erfolgreiches Modell öffentlich-privater Kooperation weitgehend unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit blieb. Seit den frühen 1990er Jahren sind Kommunen und private Unternehmen vielfältige Bündnisse eingegangen, die in gemeinsamen Unternehmen institutionalisiert wurden. In der überwiegenden Zahl der Fälle behielten die Kommunen die Mehrheit der Anteile und damit auch das letzte Entscheidungsrecht. Die privaten Partner brachten dagegen die im überregionalen und spartenübergreifenden Geschäft gewonnene Expertise ein. Gemeinsam wurden die Unternehmen weiterentwickelt und auf die aktuellen Herausforderungen angepasst. Voluminöser Verträge bedurfte es nicht, denn beide Seiten hatten ihre Interessen dauerhaft in einer gemeinsamen Gesellschaft gebündelt. Eventuelle Kontroversen landeten nicht vor Gericht, sondern wurden in den unternehmensinternen Gremien ausgetragen. Die private Seite profitiert von der engen Kundenbindung und die kommunale vom technischen und betriebswirtschaftlichen Know-how. Landauf, landab engagieren sich tausende solcher gemischtwirtschaftlichen Unternehmen in nahezu allen Sparten der Daseinsvorsorge. Die mediale Resonanz ist äußerst gering, was natürlich ein Indiz für die Seriosität und Effizienz dieser Kooperationen ist. Einzig die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe hat ein großes öffentliches Echo hinterlassen. Weil sie Ende der 1990er Jahre ein Novum darstellte, weil sie schlecht und intransparent kommuniziert wurde, weil es sich um das – auch medial – besonders sensible Gut Wasser handelte und weil sich die beteiligten Akteure zulasten der Bürger eine geheime Gewinngarantie zusicherten. Der rasant wachsende politische Druck führte schließlich zur Rekommunalisierung, doch selbst in diesem kontroversen Fall war die Bilanz mindestens gemischt. Die Anschlussquoten und die Wasserqualität sind merklich gestiegen, die betrieblichen Prozesse orientierten sich verstärkt an der betrieblichen Effizienz und insgesamt hat das Unternehmen in den 13 Jahren der Teilprivatisierung einen erheblichen Modernisierungsschub erhalten. Von der in der Tat äußerst fragwürdigen Gewinngarantie profitierte schließlich auch das Land Berlin, welches die Erlöse nicht zuletzt für die Refinanzierung desaströser geschäftlicher Fehlinvestitionen aus der Vergangenheit nutzte.
Fazit
Letztlich kommt es immer auch auf die konkreten Randbedingungen und natürlich auf den richtigen Partner an. In der retrospektiven Betrachtung zeigen sich jedoch auch gravierende Unterschiede zwischen den verschiedenen ÖPP-Modellen. Vertraglich basierte Kooperationen im Infrastrukturbereich dienten mehrheitlich als reine Finanzierungsoption. Und sie schufen falsche Anreize zur Umgehung sinnvoller Vorgaben einer seriösen Haushaltsführung. Besonders kritisch zu hinterfragen sind die enormen Transaktionskosten, die teilweise erheblichen Nachforderungen und das hohe Prozessrisiko.
Die Zusammenarbeit in gemischtwirtschaftlichen Unternehmen der Daseinsvorsorge läuft hingegen in toto deutlich reibungsloser und führt im Regelfall zu einem gemeinsamen Mehrwert für beide Seiten. Derartige Konstellationen werden auch von den kommunalen Amts- und Mandatsträgern deutlich positiver bewertet und so erscheint es mir sinnvoll, das eine von dem anderen zu trennen. Denn Kooperationen zwischen Kommunen und privaten Unternehmen haben sich mitnichten überlebt, sondern sind vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der Digitalisierung und der beabsichtigten Nachhaltigkeitswende mehr als angezeigt. Das gemischtwirtschaftliche Unternehmen mit einer kommunalen Mehrheits- und einer signifikanten privaten Minderheitsbeteiligung hat sich in diesem Zusammenhang als sinnvolles Vehikel erwiesen.

